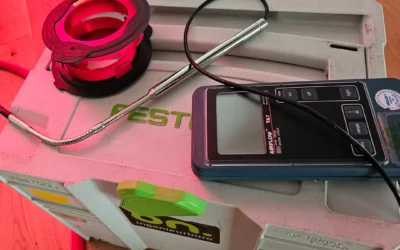Die Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG) ist komplex und umfasst verschiedene Förderprogramme für Neubau und Sanierung von Wohn- und Nichtwohngebäuden in Deutschland. Eingebettet in die Ziele des Klimaschutzprogrammes 2030 der Bundesregierung wird die Förderung energieeffizienter Gebäude vorangetrieben. Rechtliche Grundlage ist unter anderem das Gebäudeenergiegesetz.
Unterstützt werden sowohl einzelne energetische Sanierungsmaßnahmen als auch systemische Maßnahmen wie die Komplettsanierung zum Effizienzhaus/Effizienzgebäude und der klimafreundliche Neubau. Insgesamt gibt es jeweils drei Förderprogramme für Sanierung und Neubau. Außerdem wird die Energieberatung für Wohngebäude gefördert.
Mit diesem Rundum-Paket soll nach und nach der gesamte Gebäudebestand in Deutschland energiesparender und klimafreundlicher werden. Die Bundesförderung unterliegt dem Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) sowie dem Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen (BMWSB). Das Bundesamt für Ausfuhrkontrolle (BAFA) und die Kreditanstalt für den Wiederaufbau (KfW) sind für die Durchführung der BEG zuständig.
BEG Einzelmaßnahmen (BEG EM): Energetische Sanierungsmaßnahmen
Bei der Sanierung von Wohn- und Nichtwohngebäuden ist jede eingesparte Kilowattstunde und jedes weniger ausgestoßene Kilogramm CO2 bedeutend. Daher ist jede energetische Sanierungsmaßnahme ein wichtiger Schritt für mehr Umwelt- und Klimaschutz. In der Bundesförderung effiziente Gebäude werden mehrere Einzelmaßnahmen mit Zuschüssen gefördert.
Für Einzelmaßnahmen an der Gebäudehülle, an der Anlagentechnik (außer Heizung) und zur Heizungsoptimierung gibt es eine Grundförderung von 15 Prozent der förderfähigen Kosten. Hier gibt es also bares Geld zurück. Mit einem individuellen Sanierungsfahrplan durch Energieberater gibt es zusätzlich einen iSFP-Bonus von fünf Prozent. Die Höchstgrenze der förderfähigen Kosten bei Wohngebäuden liegt ohne iSFP bei 30.000 Euro pro Wohneinheit und Jahr. Mit iSFP steigt die maximale Förderung auf 60.000 Euro pro Jahr und Wohneinheit. Die Höchstgrenze der förderfähigen Ausgaben für energetische Einzelmaßnahmen Gebäudehülle, Anlagentechnik und Heizungsoptimierung beträgt bei Nichtwohngebäuden insgesamt 500 Euro pro Quadratmeter Nettogrundfläche. Für die Einzelmaßnahme „Errichtung, Umbau und Erweiterung eines Gebäudenetzes“ gibt es eine Grundförderung von 30 Prozent. Die Förderanträge für die bisher genannten Einzelmaßnahmen werden beim BAFA gestellt. Die notwendige Fachplanung und Baubegleitung für diese Einzelmaßnahmen werden pro Kalenderjahr mit 50 Prozent der förderfähigen Kosten gefördert. Bei Ein- und Zweifamilienhäuser werden maximal 5.000 Euro gefördert, ab drei Wohneinheiten maximal 2.000 Euro pro Wohneinheit (insgesamt maximal 20.000 Euro). Bei Nichtwohngebäuden werden ebenfalls 50 Prozent der förderfähigen Ausgaben für Fachplanung und Baubegleitung erstattet. Die Höchstgrenze ist gedeckelt auf fünf Euro pro Quadratmeter Nettogrundfläche (insgesamt maximal 20.000 Euro).
Der Umstieg auf Heizen mit erneuerbaren Energien wird ebenfalls als BEG Einzelmaßnahme gefördert. Die Förderung für die Einzelmaßnahme Heizungstausch geschieht allerdings bei der KfW. Für den klimafreundlichen Heizungstausch gibt es eine Grundförderung von 30 Prozent. Gefördert werden auch der Anschluss an ein Wärmenetz. Darüber hinaus werden Boni von 20 bis 30 Prozent wie der Klimageschwindigkeits- oder der Einkommensbonus vergeben. Einen Fünfprozent-Effizienzbonus gibt es für bestimmte Wärmepumpen. Der maximale Fördersatz kann sich somit bei der Heizungsförderung auf bis zu 70 Prozent summieren.
Zusätzlich vergibt die KfW einen Einzelmaßnahmen Ergänzungskredit für Wohngebäude. Dieser kann in Anspruch genommen werden, wenn für Einzelmaßnahmen bereits ein Zuschuss zugesagt oder bewilligt wurde. Voraussetzung: Der Zuschuss (der KfW oder der BAFA) ist noch nicht ausgezahlt und liegt nicht länger als zwölf Monate zurück.
Hier finden Sie noch ausführlichere Informationen zur BEG Einzelmaßnahmen
BEG Wohngebäude (BEG WG): Sanierung zum Effizienzhaus
Die Sanierung von Bestandsgebäuden bietet das wohl größte Potenzial für langfristige Energieeinsparungen. Ein Schlagwort ist hierbei das sogenannte Effizienzhaus beziehungsweise Effizienzgebäude. Die Komplettsanierung eines Bestandsgebäudes, das älter als fünf Jahre ist, auf den Effizienzhaus-Standard wird in der Bundesförderung für effiziente Gebäude berücksichtigt. Der energetische Standard „Effizienzhaus“ für Wohngebäude zeichnet sich durch seine energieeffiziente Bauweise und Anlagentechnik aus. Konkret werden der Gesamtenergiebedarf und die Wärmedämmung der Gebäudehülle betrachtet. Die KfW hat die Bewertungskriterien für den Effizienzhausstandard definiert. Welche Voraussetzungen im Detail erfüllt werden müssen, wissen dann die Energieeffizienz-Experten und -Expertinnen, die für eine Sanierung hinzugezogen werden sollten.
Saniert werden können sowohl Ein- oder Mehrfamilienhäuser als auch Seniorenzentren oder beispielsweise Studierendenwohnheime. Die Förderung für Wohngebäude-Sanierung läuft über die KfW (KfW-Kreditnummer 261). Für die Sanierung eines Effizienzhauses unterstützt die KfW mit einem Förderkredit bis zu 120.000 Euro pro Wohneinheit mit Tilgungszuschuss. Mit dem Erreichen einer Erneuerbare-Energien-Klasse (EE-Klasse) oder einer Nachhaltigkeits-Klasse (NH-Klasse) erhöht sich die maximale Fördersumme auf 150.000 Euro je Wohneinheit.
Durch eine Kombination verschiedener energetischer Maßnahmen wird nach der Sanierung schließlich eine sogenannte Effizienzhaus-Stufe erreicht. Je nachdem, welche Stufe (40, 55, 70, 85 und Denkmal) erreicht wird, erhöht sich der Tilgungszuschlag für den Förderkredit. Das bedeutet, beispielsweise bei der Sanierung auf den höchstmöglichen Effizienzhaus-40-Standard, liegt der Tilgungszuschuss bei 20 Prozent von maximal 120.000 Euro Kredit. Mit einer EE- oder NH-Klasse erhöht sich die Kreditsumme auf 150.000 Euro und der Tilgungszuschuss auf 25 Prozent. Und falls ein sogenanntes „Worst Performing Building“ zu einem Effizienzhaus saniert wird, gibt es einen Extra-Tilgungszuschuss von zehn Prozent.
Hier finden Sie noch ausführlichere Informationen zur BEG Wohngebäude.
BEG Nichtwohngebäude (BEG NWG): Sanierung zum Effizienzgebäude
Neben Wohngebäuden können auch Nichtwohngebäude energieeffizient saniert werden. Für die Komplettsanierung auf ein Effizienzgebäude stellt die KfW 2.000 Euro pro Quadratmeter Nettogrundfläche – insgesamt bis zu zehn Millionen Euro Kredit pro Vorhaben zur Verfügung (KfW-Kreditnummer 263). In der Sanierung von Nichtwohngebäuden können die Effizienzhaus-Stufen 40, 55 und 70 sowie Denkmal erreicht werden. Je höher die Effizienzhausstufe desto höher ist der Tilgungszuschuss zum Förderkredit. Für ein Effizienzgebäude Denkmal gibt es fünf Prozent Tilgungszuschuss. Für die höchste Stufe Effizienzgebäude 40 liegt der Tilgungszuschuss bei 20 Prozent. Der Tilgungszuschuss steigt um fünf Prozent sollte zusätzlich eine Erneuerbare-Energien- oder Nachhaltigkeits-Klasse erreicht werden.
Finanzielle Unterstützung gibt es auch für die Baubegleitung und Nachhaltigkeitszertifizierung. Beides wird mit zusätzlichen Kreditbeträgen samt Tilgungszuschuss von 50 Prozent gefördert. Das funktioniert so: Der für die Sanierung beantragte Kreditbetrag kann um zehn Euro pro Quadratmeter aufgestockt werden. Maximal werden so 40.000 Euro pro Sanierungsvorhaben für ein Effizienzgebäude durch die Förderung der Baubegleitung beziehungsweise der Nachhaltigkeitszertifizierung aufgestockt. Davon werden wiederum 50 Prozent als Tilgungszuschuss gefördert: also bis zu 20.000 Euro.
Außerdem gibt es für ein sogenanntes „Worst Performing Building“, welches zu einem Effizienzgebäude saniert wird einen Extra-Tilgungszuschuss von zehn Prozent.
Hier finden Sie noch ausführlichere Informationen zur BEG Nichtwohngebäude
Klimafreundlicher Neubau (KFN): Neubau-Förderung für Wohn- und Nichtwohngebäude
Mit dem Förderprogramm Klimafreundlicher Neubau (KfW-Kreditnummer 297/298) werden klimafreundliche Wohn- und Nichtwohngebäude und Eigentumswohnungen mit Förderkrediten unterstützt. Ziel ist es eine klimafreundliche Bauweise im Neubau zu fördern. Dabei wird sowohl der Erstkauf als auch der Bau eines klimafreundlichen Wohn- und Nichtwohngebäudes finanziell unterstützt. Die Förderung wird vergeben von der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW). Diese bietet Förderkredite bis zu 100.000 Euro je Wohneinheit für klimafreundliche Wohngebäude und 150.000 Euro je Wohneinheit für klimafreundliche Wohngebäude mit QNG. Für klimafreundliche Nichtwohngebäude (KfW-Kreditnummer 299) werden bis zu maximal zehn Millionen Euro Kredit je Vorhaben vergeben. Bei förderfähigen Nichtwohngebäuden im Programm Klimafreundlicher Neubau gilt: Pro Quadratmeter Nettogrundfläche gibt es bis zu 1.500 Euro Kredit. Hierbei gibt es maximal 7,5 Millionen Euro pro Vorhaben. Bei einem klimafreundlichen Nichtwohngebäude mit Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude werden bis zu 2.000 Euro pro Quadratmeter Nettogrundfläche, maximal zehn Millionen Euro pro Vorhaben gewährt.
Für die Förderung müssen die Häuser und Gebäude bestimmte Anforderungen erfüllen. Im Fokus stehen dabei die Effizienzhaus-Stufe, die Treibhausgasemissionen im Gebäude-Lebenszyklus und die Heizart. Geplant und überprüft werden diese Punkt von Energieeffizienz-Experten und -Expertinnen.
Ein klimafreundliches Wohngebäude muss die Effizienzhaus-Stufe 40 erreichen. Die Energie-Effizienz-Experten/-Expertinnen berechnen in hierfür den Jahres-Primärenergiebedarf, den Transmissionswärmeverlust und das entsprechend Referenzgebäude. Bei der Lebenszyklusanalyse, auch Ökobilanz genannt, wird das Treibhauspotenzial nach den Bilanzierungsregeln des „Qualitätssiegels Nachhaltiges Gebäude“ ermittelt. Hierbei darf maximal ein Wert von 24 kg CO2 Äquivalent pro Quadratmeter und Jahr erreicht werden. Beim Heizen muss beachtet werden, dass nicht mit Öl, Gas oder Biomasse geheizt werden darf.
Ein klimafreundliches Nichtwohngebäude muss den Standard eines Effizienzgebäudes 40 erreichen. Bei der Lebenszyklusanalyse gibt es keine für alle vorgeschriebene Grenze, sondern es wird ein projektspezifischer Anforderungswert für das Treibhauspotenzial festgesetzt. Bei dieser Variante darf ebenfalls kein Wärmeerzeuger auf Basis fossiler Energie oder Biomasse eingesetzt werden.
Sowohl ein klimafreundliches Wohngebäude als auch ein klimafreundliches Nichtwohngebäude können zusätzlich eine Nachhaltigkeitszertifizierung erhalten. Dafür müssen weitere Anforderungen des „Qualitätssiegels Nachhaltiges Gebäude“ eingehalten werden.
Hier erhalten Sie weitere Informationen zum Thema Neubauförderungen
Wohneigentum für Familien (WEF)
Für Familien, die klimafreundlich wohnen wollen, gibt es das neue Förderprogramm Wohneigentum für Familien (KfW-Kreditnummer 300). Der Fokus liegt hierbei auf der Unterstützung von Familien mit geringem und mittlerem Einkommen. Der Erstkauf oder Bau eines selbst genutzten, klimafreundlichen Wohngebäudes wird mit einem Kredit von der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) gefördert. Die Förderhöhe richtet sich dabei zum einen nach der Anzahl der mit Haushalt lebenden Kinder unter 18 und zum anderen nach dem zu versteuernden Haushaltseinkommen.
Die technischen Voraussetzungen an das Wohngebäude sind dieselben wie im Förderprogramm Klimafreundlicher Neubau. Das klimafreundliche Wohngebäude muss die Effizienzhaus-Stufe 40 erreichen, darf nicht mit Öl, Biomasse oder Gas beheizt werden und es müssen die Treibhausgasemissionen des „Qualitätssiegels Nachhaltiges Gebäude“ eingehalten werden. Es darf also maximal ein Wert von 24 kg CO2 Äquivalent pro Quadratmeter und Jahr ausgestoßen werden. Wenn gewünscht ist auch in diesem Modell eine Nachhaltigkeitszertifizierung möglich.
Hier erfahren Sie mehr über das Programm Wohneigentum für Familien
Energieberatung für Wohngebäude (EBW)
Ein weiterer Bestandteil der deutschen Förderlandschaft ist die geförderte Energieberatung für Wohngebäude durch Energieexpertinnen und -Experten. Damit werden 50 Prozent des Beratungshonorars vom BAFA bezuschusst. Es gibt jedoch Höchstgrenzen. Bei Ein- und Zweifamilienhäusern werden maximal 650 Euro übernommen und bei Wohngebäuden ab drei Wohneinheiten sind es maximal 850 Euro. Bei Wohnungseigentümergemeinschaften (WEG) sind zusätzliche 250 Euro Förderung möglich, wenn die Ergebnisse der Energieberatung während einer Wohnungseigentümerversammlung präsentiert werden.
Bei einer Energieberatung wird besprochen, wie ein Wohngebäude energieeffizienter werden kann – entweder durch eine Einzelmaßnahme oder mit Schritt für Schritt aufeinander abgestimmten Energieeffizienz-Maßnahmen, die mit einem individuellen Sanierungsfahrplan festgehalten werden.
Begriffserklärung: EE-Klasse und NH-Klasse
Eine EE-Klasse (Erneuerbare-Energien-Klasse) kann durch zwei Szenarien erreicht werden: Entweder, wenn mindestes 65 Prozent des Gebäudeenergiebedarfs ganz oder zum Teil durch unvermeidbare Abwärme erbracht wird oder, wenn mindestens 65 Prozent des Gebäudeenergiebedarfs durch eine neu eingebaute Heizungsanlage auf Basis erneuerbarer Energie gedeckt wird.
Ein Effizienzhaus/ ein Effizienzgebäude kann eine NH-Klasse (Nachhaltigkeits-Klasse) erreichen, wenn für das Haus beziehungsweise Gebäude mit dem „Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude“ zertifiziert wurde. Dazu muss eine Nachhaltigkeitszertifizierung bei einer akkreditierten Zertifizierungsstelle durchgeführt werden.
Worst Performing Building (WPB)
Ein sogenanntes Worst Performing Building (WPB) gehört zu den schlechtesten 25 Prozent Wohn- und Nichtwohngebäude hinsichtlich ihres energetischen Sanierungszustandes in Deutschland. Grundlage für die Einstufung als Worst Performing Building sind entweder ein gültiger Energieausweis oder das Gebäudebaujahr sowie der Sanierungsstand der Außenwand.
Ein Wohngebäude gilt als ein WPB wenn es laut Energieausweis in die Klasse H fällt. Falls es einen älteren Energieausweis ohne Klassifizierung gibt (ausgestellt vor 2024), gilt ein Gebäude als WPB, wenn es einen Endenergie-Wert von mindestens 250 kWh/(m²a) hat.
Quellen: KfW, BAFA, BMWK, BMWSB
Disclaimer: Alle Angaben sind zu Informationszwecken bestimmt und in keiner Weise bindend. Es gelten die Regelungen der Bundesförderung für effiziente Gebäude in ihrer aktuellen Fassung. Alle Angaben ohne Gewähr. Es besteht kein Anspruch auf Vollständigkeit, Aktualität oder Richtigkeit.
Stand: Mai 2024